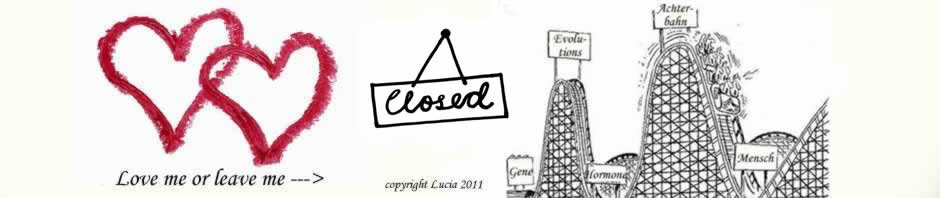Weibliche Wirklichkeit – Frauen in der Männerwelt:

Die Autorin über ihr Buch:
Wir lebten in der Illusion, unsere Welt sei die einzig mögliche und gültige Welt. Die Entdeckung, dass der andere existiert – gehöre dieser einem anderen Geschlecht, einer anderen Generation oder einer anderen Tradition an -, zwingt uns, den Horizont dieser Welt neu zu denken. Während zuvor eine Logik des Selben, des Gleichen, des Identischen unsere Denk-, Seins-, und Koexistenzweise dominierte, müssen wir von nun an den Akzent auf die Differenz legen. Die Natur lehrt uns, dass eine Differenz, eine einzige, gleichfalls universell und qualitativ ist, diejenige, die die Menschheit in zwei Geschlechter teilt: Mann und Frau, die tatsächlich verschiedene Welten bewohnen. Die Geschlechterdifferenz dient also als Grundlage, eine weltweite Kultur zu konstruieren, in der das Verhältnis zwischen Natur und Kultur ausgearbeitet wird, ohne die natürliche Zugehörigkeit kulturellen Kriterien zu unterwerfen, die sich von einer Tradition zur anderen unterscheiden. Das Absolute befindet sich nun an der Grundlage jedweder Kultur im Respekt vor der sowohl natürlichen als auch kulturellen Transzendenz des anderen. Die Berücksichtigung dieser horizontalen Transzendenz erlaubt es, das Werden der Menschheit ausgehend von einer konkreten globalen Identität weiterzuverfolgen und Brücken zwischen den verschiedenen Traditionen zu bauen, denn sie ist universell teilbar – anders als die vertikale Transzendenz, in die jede Tradition auf ihre eigene Weise ihr Absolutes (die Wahrheit, das Gute, Gott) projiziert. In Welt teilen geht die Genauigkeit der theoretischen Analysen einher mit praktischen Vorschlägen, wie die relationalen Beziehungen zum anderen kultiviert werden können, von der intimsten bis zur weltweiten politisch-kulturellen Ebene.
Die Autorin:
Luce Irigaray ist eine führende Denkerin in den Bereichen Gegenwartsphilosophie, Psychoanalyse und Feministische Theorie. Ihre bekanntesten Werke sind Speculum. Spiegel des anderen Geschlechts (1974/1980), Das Geschlecht, das nicht eins ist (1977/ 1979) und Ethik der sexuellen Differenz (1984/1991).
ISBN 978-3-495-48400-5
Einleitung: Die Transzendenz des anderen.
Wenn die Welt der Transzendenz entspricht, die als Horizont der Totalität all dessen, was existiert, von einem einzigen Subjekt projektiert ist, wandelt diese Welt Zeit in Raum um. Auch wenn eine solche Transzendenz ein zeitliches Projekt des Subjekts repräsentiert, führt die Tatsache, dass dieses Subjekt von einem einzigen Standpunkt aus die Sammlung oder die Eingrenzung der Gesamtheit endlicher Dinge sicherstellt, dazu, dass die Welt sich als Kreis schließt, schon im Vorhinein. Die Intuition des Unendlichen mag bestehen bleiben, aber in den dynamischen, selbst in den dialektischen Beziehungen von Zeit und Raum erstarrt etwas. Der Übergang von einem Horizont in den anderen, einer Epoche der Geschichte zu einer anderen wird sich infolgedessen nicht ohne Schaden vollziehen: beispielsweise nicht ohne Krieg, Hegel zufolge, nicht ohne Zerstörung oder Dekonstruktion, laut Heidegger. 
Wenn die Transzendenz jedoch ihren Ursprung auch im Respekt gegenüber der irreduktiblen Differenz des anderen hat, in der Tatsache, dass seine Alterität für mich niemals erkennbar, von mir nicht anzueignen ist – obgleich der andere, er oder sie, sich meinen Wahrnehmungen und sogar meinen Intuitionen als endlich darstellt -, entspricht die Transzendenz nicht mehr bloß einer Objektivation der Projektion meiner eigenen Subjektivität. Unter der Bedingung, dass dieses andere Subjekt angesichts einer differenten Welt, insbesondere meiner Welt, lebendig und frei bleibt, sind Zeit und Raum auf immer undefinierte und offene Weise in einem dialektischen Prozess zwischen uns aufrecht erhalten.
Zutreffend ist, dass ich dann darauf verzichten muss, auf solitäre Art und Weise – oder eine von allen, vermeintlich gleichen Subjekten derselben Epoche geteilte Art – den Horizont einer Welt als Transzendenz zu entwerfen. In dem Moment, wo ich die Alterität des anderen als eine anerkenne, die nicht auf die meine und das, was mir eigen ist, zu reduzieren ist, wird die Welt nicht auf eine einzige zu reduzieren sein: Es gibt immer zumindest zwei Welten. Die Totalität, die ich entwerfe, ist jederzeit durch diejenige in Frage gestellt, die der andere entwirft. Die Transzendenz, die Welt repräsentiert, ist also weder eine noch die einzige.
Und wenn die Geste, die Totalität einer Welt zu entwerfen, als eine Geste bestehen bleiben kann, die sich auf das Transzendentale bezieht, so ist die Geste, die Partialität einer solchen Transzendenz anzuerkennen, noch transzendentaler. Sie öffnet den autologischen Kreis des transzendentalen Horizonts eines einzigen Subjekts im Namen dieser Wahrheit: Das menschlich Reale besteht aus zwei Subjekten, die nicht aufeinander zu reduzieren sind. Da jedes eine eigene Art besitzt, (sich) einen Horizont zu entwerfen, der die Totalität dessen umfasst, was existiert, wird die transzendentale Geste, die jeder menschlichen Existenz eigen ist, zu derjenigen, in Relation zum anderen eine Beziehung zu konstruieren, in der Raum und Zeit in jedem Augenblick un-end-lich und im Werden sind.
Der Mann transzendiert sich in eine Welt, um sich eine Einheit zu geben, indem er die Gesamtheit dessen, was er wahrnimmt, auf einen gegenwärtigen, aber stets auch zukünftigen Horizont projiziert. Dieses transzendentale Projekt benötigt der Mann, um im Verhältnis zu seinem Ursprung, insbesondere dem mütterlichen, eine eigene Identität zu erwerben.
In dieser Geste projiziert er jedoch nicht nur das, was er ist, sondern eine Wahrnehmung aller Lebewesen, in deren Mitte er sich befindet. Die Einheit, die er somit bildet oder eingrenzt, ist also nicht nur die seine, sondern diejenige eines Erscheinens, das er bezüglich seiner Umgebung zu repräsentieren glaubt. In Wirklichkeit ist das, was das männliche Subjekt konstituiert, eine Art neue Plazenta, in der es Schutz sucht, indem es sich von seiner natürlichen Geburt trennt.
Dieser Entwurf eines Horizonts ist für das Subjekt notwendig, um sich von der Zugehörigkeit zu oder (Kon-)Fusion mit seinem mütterlichen, uterinen Ursprung zu distanzieren. Und die historische Epoche, die das Subjekt derart ausarbeitet, ist nur eine neue Modalität oder Gestalt seines Versuchs, sich bezüglich jenes Ursprungs zu unterscheiden. Diese Konstruktion eines transzendentalen oder idealen Standpunkts ist bezogen auf die menschliche Realität doppelt problematisch. Gewiss, sie bedeutet eine partiell bereits erworbene Individuation übertreffen zu wollen, einen bereits erreichten Status, aber unsicher ist, ob dieser einer spezifisch menschlichen Realität entspricht. Er verweist eher auf eine Etappe hin zum Ereignis dieser Realität.
Der Entwurf einer Welt entspricht also nicht notwendigerweise dem Entwurf, der auf eine menschliche Welt abzielt. Wenn zudem das Projekt einzig von der Absicht des Mannes ausgeht, ist es zugleich partiell und parteiisch. Und wenn die Welt sich dann als menschliche Realität ausgibt, erlegt sie uns eine Konzeption dieser Realität auf, die weit davon entfernt ist, deren Totalität, also die Wahrheit, auszudrücken und zu enthüllen. Diese Verfehlung ist umso schwerwiegender als der Horizont der Welt, der somit den Sinn determiniert, sich in der Form von Imperativen, Apriori, Gesetzen, Idealen präsentiert, die das Werden einer differenten menschlichen Realität lähmen, insbesondere indem es daran gehindert wird, sich in eine Welt zu transzendieren, die ihr entspräche.
Mehr noch, da die Projektion einer Welt jeder Repräsentation, jedem Urteil, ja, selbst dem Bewussten vorausgeht, kann sie nicht auf rationale Weise in Frage gestellt werden. Sie liegt sogar vor den Worten, a fortiori vor jedem möglichen Dialog. Jedem verbalen Austausch obliegt es, die Permanenz der Projektion durch Äußerungen zu sichern, die aber bezüglich der Grundlegung der Welt tatsächlich tautologisch sind. In diesem eingekreisten Horizont, der zu jedem Zeitpunkt endlich ist, kommt die Debatte des Mannes mit sich selbst und seinesgleichen gewissermaßen der abgedroschenen Wiederholung einer vorgegebenen Realität und Wahrheit gleich.
Diese Debatte ohne jedwede Freiheit währt bis zu dem Moment, wo ein differentes Subjekt oder ein Ereignis in der Umgebung – eine explosive Überlastung zum Beispiel – den Horizont zerreißt und dazu zwingt, einen anderen zu entwerfen. Was nicht ohne irgendeine Katastrophe oder Verwerfung geschieht. Das Scheitern der Transzendenzen oder Ideale ereignet sich nicht, ohne dem Mann, seinesgleichen, seinem Umfeld Schaden zuzufügen. Und die Ankündung neuer Werte wird gemeinhin angefochten, bis das Umfeld davon durchdrungen ist und sie als quasi unabänderliche Realitäten oder Wahrheiten auferlegt. Nachdem es ihrer Neuheit gegenüber immun geworden ist?
In der Tat räumt eine solche Konzeption von Welt und menschlicher Realität dem Mann selbst nur eine illusorische Freiheit und eine Spontaneität ohne mögliche transzendentale Verwirklichung ein. Zumindest trifft dies auf die meisten zu. Es lässt sich an der Verwendung eines Energieüberschusses messen – zum Beispiel der sexuellen Energie. Eine Energie, die sich im Horizont einer Welt entfalten könnte, die im Hinblick auf das Teilen des Begehrens erbaut wird, erschöpft sich vielmehr in sekundären, solitären, »schändlichen« oder kriegerischen Aktivitäten ...
Dort, wo Freiheit dringend notwendig wäre, um die menschliche Realität als solche zu verwirklichen, ist sie nicht mehr vorhanden, gefangen in Idealen oder Verpflichtungen, wird ihr vordringlichster Imperativ nicht beachtet: Die Entwicklung einer Energie zu kultivieren, die immer schon mit dem anderen verbunden ist, in Hinblick darauf, eine spezifisch menschliche Transzendenz auszuarbeiten.
Die Freiheit, die im Verhältnis zum historischen Fundament einer Welt gewissermaßen spontan und autonom ist, ist jederzeit imstande, sich in Transzendenz zu verwandeln, ohne sich von der Quelle ihres Elans abzuschneiden. Anstatt sich auf den Horizont einer Welt zu projizieren, muss sie sich also bewahren, zurückhalten, sich beherrschen oder zügeln angesichts des anderen als anderen, ein anderer, der in seiner Transzendenz anerkannt wird und mit dem es gilt, Relationen auszuarbeiten, ohne die Dualität der Subjekte noch den/die Unterschied(e) zwischen ihnen aufzuheben.
Zu behaupten, die menschliche Realität sei durch die Gesamtheit dessen bestimmt, was in der Welt einzig in der Eigenschaft von Seienden existiert, gehorcht zweifellos den Notwendigkeiten und Grenzen männlicher Subjektivität. Das Selbst des Mannes wird zunächst von einem anderen empfangen, der, indem er ihn umhüllt, als anderer für ihn nicht wahrnehmbar ist: die Mutter. In Ermangelung, sie als Transzendenz anzuerkennen, in der er seinen ersten Ursprung hat, projiziert der Mann den Ursprung seiner selbst auf die Totalität der Welt, es sei denn, er extrapoliert ihn in Gott.
Der andere, der ihm nahe ist, der andere, durch den er sich empfängt, wird in seiner Transzendenz nicht anerkannt. Die Mutter, und dann die Frau, bleiben einer nur natürlichen Welt assimiliert, aus der es notwendig ist herauszutreten, um Mann zu werden. Sie hingegen werden nicht als eine vollständige menschliche Realität anerkannt, die (sich) anders als der Mann transzendiert. Die Mutter, die Frau existieren hinsichtlich ihrer selbst ausgehend von einer In-stase und nicht einer Ek-stase.
Ihre Welt konstituiert sich dank des Respekts vor dem anderen, auch in ihnen selbst, und nicht durch Projektion der Totalität dessen, was außerhalb von ihnen existiert, wie es für den Mann zutrifft.
Der Transzendenz Ausdruck zu verleihen, erfordert seitens der Frau und des Mannes verschiedene Modalitäten. Für die Frau handelt es sich darum, sich zurückzuziehen oder zu beschränken, um in sich selbst einen Ort der Gastfreundschaft für den anderen bereitzustellen, ohne Aneignung, Fusion oder Konfusion. Für den Mann handelt es sich eher darum, eine eigene Identität zu erwerben gegenüber dem ersten Aufenthalt oder der ersten Umgebung, durch die er sich empfangen hat, indem er das Eksistieren einer möglichen eigenen Welt in eine Gegenwart projiziert, die immer zukünftig ist.
Diese Art, sich von der Mutter zu unterscheiden, berücksichtigt sie nicht als andere, es sei denn negativ. Sie stellt einen Versuch dar, sich zu entfernen, ohne eine Rückkehr. Die Errichtung einer Welt, die ihm eigen ist, wird für den Mann zu dem oft unbewussten Vorgang, auf einen ersten Aufenthalt in der Mutter zu kontern, auf ein Begehren zu antworten, in der Frau zu bleiben, auf seine Notwendigkeit, in ihr seine Kinder zu zeugen. Er hüllt mit seiner Welt, mit seiner Transzendenz diejenige ein, die ihn umhüllt, ihn genährt hat. Was sie gemeinhin einem Verhältnis zu der Transzendenz beraubt, die ihr eigen ist.
Zwischen ihm und ihr, und im Gegenzug zwischen ihr und ihm, fehlt die Existenz – das Eksistieren – der Realität einer Differenz, auch in der Konstituierung der Welt und im Ausdruck einer eigenen Transzendenz. Die Möglichkeiten des einen und der anderen finden sich infolgedessen gelähmt oder verkannt. Was die Menschheit der fruchtbarsten Quelle ihres Elans, ihrer Freiheit beraubt, der Quelle, die konstant strömt, wenn jeder seiner eigenen Welt treu bleibt.
Denn eine spezifische Weise, sich auf das Transzendentale zu beziehen, befreit zu jedem Zeitpunkt eine Energie, die im Horizont einer einzigen Totalität Gefahr läuft, sich zu fixieren und zu erstarren. So aber bewahren sich für jeden und zwischen den beiden der Elan und die Grenze, welche die Rückkehr zur Quelle des Selbst gewährt. Dank des Respekts gegenüber der Transzendenz des anderen als eine, die nicht auf die eigene zu reduzieren ist, entdeckt jeder in jedem Augenblick einen neuen Elan hin zum Unendlichen – oder Unendlichen mittels der Anerkennung der Endlichkeit seiner eigenen Welt.
Das Un-end-liche kann wieder zum Horizont des Projektes eines jeden werden, dank des Akzeptierens, dass die Wahrnehmung der Totalität der Welt, die die seinige ist, notwendigerweise endlich ist.
Dieser Elan hin zum Un-endlichen – oder Unendlichen -kann dann un-endlich – oder unendlich das Werden der Beziehung zwischen den beiden Welten unterstützen oder herstellen. Allerdings ist es nötig, dass diese in ihrer Dualität anerkannt werden und dass jede Subjektivität sich darum sorgt, die Konstituierung seiner eigenen Welt sicherzustellen in der Absicht, die menschliche Realität, in der er oder sie sich bereits situieren, zu transzendieren.
In dieser Realität sind der andere und sein transzendentales Projekt präsent. Jedes Subjekt ist immer schon durch das Existierende, das der andere ist, affiziert. Jedes Subjekt steht immer schon in Beziehung zu einem anderen. Dies ist auf einer natürlichen Ebene der Fall, durch die Intuition und die Erfahrung, derselben Spezies anzugehören, und dies ist auf einer transzendentalen Ebene so, durch die Tatsache, in der Welt zu koexistieren. Dieses Transzendentale ist jedoch in seiner Intentionalität pervertiert, wenn es nicht die Dualität der Welten berücksichtigt. Dies setzt voraus, dass jedes Subjekt seine Intentionen hinsichtlich des anderen hinterfragt, bevor es einen gleichzeitig einzigen und antizipierenden Horizont in die Totalität des Existierenden projiziert. Uns über unsere Beziehung zum anderen als anderen zu befragen wird zur Möglichkeit, das in Transzendenz zu verwandeln, worin wir immer schon durch ihn affiziert worden sind.
Die tatsächliche Koexistenz, die unser Zusammensein konstituierte, kann somit Koexistenz von In-tentionalitäten werden, deren transzendentale Dimension in stärkerem Maße der menschlichen Realität oder Wahrheit entsprechen wird. Das transzendentale Projekt wird ebenfalls stärker auf die Ebene der bewussten und frei entschiedenen Intention verlagert angesichts des nicht-menschlich Existierenden, des Selbst, des anderen, der in seiner natürlichen wie transzendentalen Differenz anerkannt wird.
In der Beziehung zum Selben (zu Seinesgleichen) zu verharren, führt in der Tat dazu, dass die Transzendenz der natürlichen Zugehörigkeit oder der Zugehörigkeit zu einer angenommen gemeinsamen Welt verhaftet bleibt.
Die Beziehung zum nicht-menschlich Existierenden, aber mehr noch zum menschlich Existierenden, muss im Horizont einer Realität neu gedacht werden, in der das relationale Sein mit dem anderen nicht durch das Projekt einer eigenen Welt verdunkelt werden kann. Was so lange möglich bleibt, wie die Beziehung nur unter Gleichen stattfindet, in der Annahme, eine einzige und gemeinsame Vision der Welt zu teilen. Hierin besteht zum Teil der Irrtum der abendländischen Philosophie: die menschliche Individualisierung ausgehend von einer einzigen Transzendenz, die den Notwendigkeiten des männlichen Subjekts entspricht, verfolgt zu haben. In diesem einzigen Projekt, das die Gesamtheit des Existierenden betrifft, kann die Frau ihre transzendentalen Möglichkeiten nicht entdecken.
Und in der fehlenden Anerkennung einer doppelten menschlichen Subjektivität bleibt ein Teil seiner Möglichkeiten dem Mann selbst verschleiert.
Gewiss, die Natur der doppelten – oder vielmehr dreifachen – Transzendenz, die so skizziert als möglich und sogar notwendig entdeckt wird, bleibt partiell verschleiert. Nur indirekt erweist sich ihre Möglichkeit oder gar Notwendigkeit als ein Mittel, das In-der-Welt-Sein des weiblichen Subjekts zur Entfaltung zu bringen wie auch die menschliche Beziehung zwischen natürlichen differenten Subjekten. Zu diesem Ereignis trägt entschieden die Aufgabe des weiblichen Subjekts bei.
Die Frau muss sich von der Welt trennen, die ihr als einzige auferlegt ist, eine Welt gründen, die ihr eigen ist, und die Mittel zur Koexistenz mit einer Welt definieren, die sich nicht auf die ihrige reduziert.
Die Welt, die so entsteht, stellt in der Tat einen Fortschritt im menschlichen Werden dar unter der Bedingung, dass sie sich nicht ihrerseits als einzige Welt auferlegt, die blind der Gesamtheit dessen, was existiert, das Gesetz diktiert. Es ist wichtig, dass diese weibliche Welt in ihrer Grundlage und in ihrer Legitimation die Transzendenz des anderen beachtet und so jeder menschlichen Realität erlaubt zu existieren – und zu ek-sistieren -, inmitten des Existierenden in seiner Gesamtheit.
Die Frau ist veranlasst, die Transzendenz des anderen anzuerkennen, da diese Geste an der Grundlage und der Entwicklung ihrer eigenen Beziehung zur Transzendenz teilnimmt. Notwendig ist jedoch, dass sie selbst und durch sich selbst entdeckt, was ihrer Welt eine transzendentale Grundlage gewährt. Kein männliches Wesen allein, und sei es göttlich, kann der Frau einen transzendentalen Status zuweisen. Gesetzt den Fall, verbleibt sie in der Welt des anderen. Sie errichtet keine Welt in Übereinstimmung mit ihren Notwendigkeiten und ihren Möglichkeiten. Dies erfordert eine eigene transzendentale Grundlage, neben der des Mannes, die als menschliche Realität anerkannt wird, dazu bestimmt, zum und mit dem anderen in relationaler Beziehung zu stehen.
Die Betonung auf die relationale Beziehung zum anderen als eine irreduktible Dimension der menschlichen Realität und Freiheit zu legen, verlagert die Sorge bezüglich der Temporalität. Es handelt sich nun nicht mehr nur darum zu dauern oder zu überleben, sondern das Werden seiner selbst, des anderen und der Beziehung zwischen beiden aufrechtzuerhalten.
Das Werden als solches, das im Spiel ist, ist zweifellos spezifisch menschlich. Aber anstatt eine notwendige Aufgabe in unserer gegenwärtigen Existenz – oder unserem Ek-sistie-ren – zu bleiben, ist das Ziel dieses Werdens ins Jenseits verlagert worden. Unsere Verwirklichung hinge davon ab, eine andere Welt, eine andere Natur zu erlangen, und nicht davon, diese Welt hier und unsere eigene Natur zu transformieren. Die Notwendigkeit, die Verwirklichung des Menschlichen in eine andere Welt zu projizieren und sie von einer Transzendenz abhängig sein zu lassen, die seiner Humanität gegenüber fremd ist, erklärt sich zweifellos durch eine Konstituierung der Welt, in der die Transzendenz des anderen als anderer verkannt wird.
In diesem Fall wird ein Teil der menschlichen Realität – und infolgedessen die menschliche Realität in ihrer Totalität – seiner inhärenten Motivationen und der Gründe beraubt, in denen die Motivationen ihre Grundlage und ihren Elan finden. Daraus kann resultieren, dass ein Subjekt für das andere das Sein repräsentiert, aber das heißt noch nicht, selbst zu einem Sein zu gelangen, indem eine Transzendenz frei auf sich genommen wird, die imstande ist, eine eigene Welt zu gründen. Eine Welt, deren affektive Dimension sich unaufhörlich auf ihre Überschreitung hin projiziert, sodass sie eigener Affekt bleiben kann, während sie geteilte Beziehung wird dank der Vermittlung einer Transzendenz, die die Dualität der Freiheiten und Wahrheiten respektiert.
Das setzt voraus, dass jeder Sorge dafür trägt, seinen Elan zu erhalten, aber auch ihn zu beschränken im Hinblick auf ein Werden, das sich sowohl als eigene Welt und als Beziehung zum anderen von den Relationen zwischen zwei Welten nährt.
Die Grenze der Freiheit kann sich unterschiedlich situieren, und die Freiheit selbst kann ihren Impetus von einem Realen, einer mehr oder weniger menschlichen Realität aus nehmen. In der Entwicklung des westlichen Denkens ist die Freiheit noch nicht verwurzelt im Einklang mit dieser spezifischen menschlichen Aufgabe, die darin besteht, den Übergang von der Natur zur Kultur relational zwischen menschlichen Subjektivitäten zu gewähren.
Wenn dieses Aufblühen eines möglichen – und übrigens notwendigen – Werdens noch nicht stattfand, kann das an der Tatsache liegen, dass die Differenz zwischen Mann und Frau noch nicht anerkannt ist als diejenige, die eine transzendentale Grundlage erlaubt und sogar benötigt. Diese Differenz mit einem solchen Horizont zu versehen erfordert, dass der Elan der Freiheit seine Quelle in einem spezifisch menschlichen Realen und einer derartigen Realität findet und nicht in einem sexuellen oder prokreativen Instinkt, der nicht nur der Menschheit eigen ist.
Das setzt voraus, dass die spontane Energie der Anziehung zwischen den Geschlechtern sich in Gefühle, in Gedanken transformiert, ohne sich deswegen zu verleugnen oder auszulöschen. Die sexuelle Anziehung als einen ursprünglichen Elan in der Beziehung zwischen den Menschen zu kultivieren, bleibt eine Aufgabe, um die sich die westliche Kultur nicht mit dem nötigen Ernst gekümmert hat. Durch diese Aufgabe jedoch kann sich die Menschheit von den anderen Spezies distanzieren und einen Elan sowie Grenzen entdecken, die ihr eigen sind. Das macht die Konstruktion einer wirklich menschlichen Welt möglich.
Die menschliche Freiheit ist weder bloße natürliche Spontaneität noch bloßer Impetus, erzeugt als retroaktiver Effekt der Antizipation der Totalität einer Welt durch ein alleiniges und einziges Subjekt. Sie ist mysteriöser in ihrem Ursprung und in ihrer Finalität. Sie ähnelt einem Saft, der sich in einer zarten Pflanze ausbreitet, die wächst oder vergeht, je nachdem, ob die Umgebung, in der sie sich zeigt, günstig oder nicht günstig für ihre Existenz, ihr Werden ist. Die Aufnahme, die der Elan der Freiheit bei dem anderen findet, und der Beitrag, den der andere seinerseits dazu leistet, wirken gleichfalls auf ihre Möglichkeit, in einem Mehr an Wissen und Respekt gegenüber der menschlichen und nicht-menschlichen Realität, also der Wahrheit, zu gründen.
Infolgedessen werden das Projekt einer eigenen Welt und das einer geteilten Welt dem getreuer, was existiert, und wenn sie eine transzendentale Geste bezogen auf das Gesamt des Existierenden darstellen, ist es in Hinblick darauf, es in seinem eigenen Leben zu kultivieren und nicht es zu dominieren.
Gegründet in dem Respekt vor dem nicht-menschlich Seienden, gegenüber sich selbst, dem anderen, der in seiner Differenz gesehen wird, verliert die Freiheit ihren unergründlichen Charakter, den diesbezüglich ein nur solitär existierendes Subjekt empfinden kann, auch wenn sie begrenzt ist. Sie ist in jedem Augenblick gezwungen, sich wieder zu definieren oder zu modulieren entsprechend den Seienden oder Existierenden, menschlich oder nicht menschlich, die sie umgeben.
Sie muss trotzdem nicht auf einen eigenen Impetus verzichten, sondern es gilt eine Ökonomie zu entdecken, die mit dem Impetus des anderen in seinem Leben oder seinem transzendentalen Projekt kompatibel ist. Die Freiheit muss in jedem Augenblick ihre Expansion begrenzen, um die anderen Existierenden zu respektieren und mehr noch, um die Mittel zu finden, mit ihnen eine Welt zu bilden, die immer im Werden ist, in der jedes Lebendige, menschlich oder nicht-menschlich, die Möglichkeit hat zu existieren.
In einer solchen Welt projiziert sich die Freiheit eines jeden Lebewesens, insbesondere des menschlichen, nicht von einer einzigen Grundlage aus in den Horizont der Totalität der Existierenden. Ihr Impetus oder ihre Grenzen – ein Begriff, den ich dem des Verlustes vorziehe – münden kontinuierlich in einen dialektischen Prozess, an dem der andere partizipiert durch das, was er beiträgt, aber auch durch das, was er als natürliche oder transzendentale Lebensmöglichkeiten entnimmt.
Ein solcher Prozess interveniert in der Konstituierung einer eigenen Welt gemäß den Möglichkeiten eines jeden. Er ist ebenfalls an der Konstituierung einer relationalen Welt zwischen jedem Existierenden und jedem anderen beteiligt. Dieser Aspekt ist besonders entscheidend bei Menschen, deren natürliche und transzendentale Realität different ist: der Frau und dem Mann.
Wenn die Freiheit somit freier ist, als sie es jemals hat sein können, trifft sie auch, und zwar aufgrund der irredukti-blen Dualität des menschlichen Realen und der Realität, auf eine Grenze, an der sie sich konstant zu messen hat. Die Existenz — oder das mögliche Eksistieren — des anderen nicht zu berücksichtigen, heißt sich selbst der Freiheit zu berauben, sowohl durch die Reduktion eines ursprünglichen Elans wie auch durch den partiellen und parteiischen Charakter der Grundlage, die den transzendentalen Impetus determiniert.
Das entspricht in der Tat, Freiheit als menschliche Freiheit zu verunmöglichen. Denn diese Freiheit kann nicht existieren, ohne die irreduktible Dualität des menschlichen Realen und die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Beziehung zwischen zwei menschlichen Existenzen – oder Eksistierenden – sich nicht auf der Ebene eines rein natürlichen Impetus halten oder dahin zurückkehren kann.